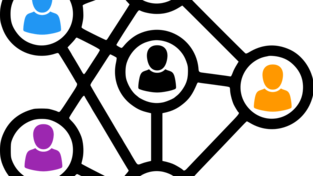Petrus hat es nicht besonders gut gemeint an diesem Sonntag, denn das Wetter war zu unbeständig, um im Ökopark Hertelsleite einen Gottesdienst zu feiern. Also wechselte man kurz entschlossen in den Franziskus-Saal. Der Altar dort war mit Pflanzen und Deko-Objekten themengerecht geschmückt. Das Lied „Erfreue dich, Himmel…“ (GL 467) drückte Lob und Dank an den Schöpfer und Freude über dessen Schöpfung aus. Daraufhin folgte die liturgische Eröffnung mit Gedanken zum „Biotop“, das der Ökopark Hertelsleite mit seiner großen tierischen und pflanzlichen Artenvielfalt bildet. Hier dürfe vieles wachsen, hier sei ein Ort für vielfältiges Leben, sagte Pfarrer Jung. Die Hinführung mündete ein in die Frage von Dominik Schrepfer, was denn „gutes Leben“ sei. Diese Frage zog sich als Leitmotiv durch den ganzen Gottesdienst. Im Tagesgebet bat Pfarrer Jung um Kraft, das zu tun, was dem Leben dient. Die Lesung (Genesis/1. Mose 2,4b-9.15) trug Georg Gremer vor. Das Evangelium (Lk 12,15-21) handelte von einem reichen Mann, der durch Überfluss und Reichtum Sicherheit gewinnen will. Jesus erinnert ihn daran, dass er in kürzester Zeit alles verlieren könnte.
In der Dialog-Predigt von Pfarrer Jung und Dominik Schrepfer ging es ebenso um die Frage „Wozu die Anstrengung im Leben und für wen?“ „Unterm Strich zähl ich“, so ließe sich die Antwort zusammenfassen. Auch der Kornbauer im Evangelium dachte nur an sich, an sein Wohlergehen, er wollte immer mehr. Die Erde sollte deshalb immer mehr ausgebeutet werden, immer höhere Erträge bringen.
„Wir leben eindeutig über unsere Verhältnisse – und wir müssen bescheidener werden“, mahnte auch Papst Franziskus in seiner Umwelt-Enzyklika Laudato si an. Vor 10 Jahren, am 24. Mai 2015 hat er sie veröffentlicht. Papst Franziskus hat die Probleme und Herausforderungen gesehen und klar benannt. Das Vorbereitungsteam wollte zum 10-jährigen Jubiläum der Veröffentlichung und auch als Vermächtnis des am Ostermontag verstorbenen Papstes die Enzyklika ausschnittweise zu Wort kommen lassen:
„Auf verschiedene Weise versorgen wir die weniger entwickelten Völker, wo sich die bedeutendsten Reserven der Biosphäre befinden, weiter die Entwicklung der reichsten Länder, auf Kosten ihrer eigenen Gegenwart und Zukunft. Der Erdboden der Armen im Süden ist fruchtbar und wenig umweltgeschädigt, doch in den Besitz dieser Güter und Ressourcen zu gelangen, um ihre Lebensbedürfnisse zu befriedigen ist ihnen verwehrt durch ein strukturell perverses System von kommerziellen Beziehungen und Eigentumsverhältnissen. Es ist notwendig, dass die entwickelten Länder zur Lösung dieser Schuld beitragen, indem sie den Konsum der nicht erneuerbaren Energie in bedeutendem Maß einschränken und Hilfsmittel in die am meisten bedürftigen Länder bringen, um politische Konzepte und Programme für eine nachhaltige Entwicklung zu unterstützen. […] Es gibt keine politischen und soziale Grenzen und Barrieren, die uns erlauben, uns zu isolieren und aus ebendiesem Grund auch keinen Raum für die Globalisierung der Gleichgültigkeit.
Das Verschwinden der Demut in einem Menschen, der maßlos begeistert ist von der Möglichkeit, alles ohne jede Einschränkung zu beherrschen, kann letztlich der Gesellschaft und der Umwelt nur schaden.“ (LS 52;244)
Dominik Schrepfer betonte, das „immer mehr“ habe Grenzen, darauf habe schon der Club of Rome hingewiesen. Für mehr wirtschaftliches Wachstum müssen wir immer mehr bezahlen. Die Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5 Grad und die Abbremsung des Klimawandels werde sehr teuer. Darauf antwortete Pfarrer Jung: „Aber trotzdem ist Wachstum möglich: qualitatives Wachstum – ein Mehr an Lebensqualität für alle. Dieses Wachstum gelingt nur, wenn ich meine Freiheit nicht absolut setze und damit nicht als willkürlich ansehe. […] Es geht vielmehr darum, dass ich mich in meiner Freiheit und meinen Möglichkeiten einschränken und begrenzen kann, damit auch andere, z. B. Menschen auf anderen Kontinenten und nachfolgende Generationen gut leben können.“
Da kommt die Lesung aus dem Buch Genesis ins Spiel, die im Gottesdienst zu hören war. Lange Zeit wurde sie missverstanden und falsch interpretiert. Auch darauf ist Papst Franziskus in seiner Enzyklika eingegangen:
„Wir sind nicht Gott. Die Erde war schon vor uns da und ist uns gegeben worden. […] Man hat gesagt, seit dem Bericht der Genesis, der einlädt, sich die Erde zu „unterwerfen“ (vgl. Gen 1,28), werde die wilde Ausbeutung der Natur begünstigt durch die Darstellung des Menschen als herrschend und destruktiv. Das ist keine korrekte Interpretation der Bibel, wie die Kirche sie versteht. […] Es ist wichtig, die biblischen Texte in ihrem Zusammenhang zu lesen […] und daran zu erinnern, dass sie uns einladen, den Garten der Welt zu „bebauen“ und zu „hüten“ (Gen 2,15). Während „bebauen“ kultivieren, pflügen oder bewirtschaften bedeutet, ist mit „hüten“ schützen, beaufsichtigen, bewahren, erhalten, bewachen gemeint. Das schließt eine Beziehung verantwortlicher Wechselseitigkeit zwischen dem Menschen und der Natur ein. Jede Gemeinschaft darf von der Erde das nehmen, was sie zu ihrem Überleben braucht, hat aber auch die Pflicht, sie zu schützen und das Fortbestehen ihrer Fruchtbarkeit für die kommenden Generationen zu gewährleisten.“ (LS 67)
Daraufhin äußerte Dominik Schrepfer: „Die Schöpfungserzählungen der Bibel wollen unsere menschliche Existenz erklären: Was sagen sie über den Menschen aus? Was bedeutet das konkret für uns – was bedeutet es für uns heute?“
Pfarrer Jung erklärte: „Wir müssen uns über den Begriff „beherrschen“ im Klaren sein. Beherrschen bedeutet nicht, – wie es lange Zeit im Christentum falsch verstanden wurde – die Erde auszubeuten und sich gewaltvoll untertan zu machen. Alles rausholen, was rauszuholen ist aus der profanen Welt – Leben ist woanders, im Jenseits. Unser Job ist ein anderer: Nämlich, die Erde zu bearbeiten und zu bewahren – also die uns gegebene Erde und die Grundlagen unseres Lebens zu nutzen, aber nicht auszunutzen. Auch nachfolgende Generationen sollten noch gut auf der Erde leben können.“
Dominik Schrepfer zog folgendes Fazit: „Wir müssen also vorgehen gegen die Chaosmächte unserer Zeit: Habgier, Kriege, Umweltzerstörung.“ Und Pfarrer Jung ergänzte: „Sich selbst zurücknehmen – zufrieden sein mit sich und der Welt in Frieden leben, darauf kommt es an.“ Papst Franziskus schreibt dazu:
„Kein Mensch kann in zufriedener Genügsamkeit reifen, wenn er nicht im Frieden mit sich selbst lebt. Ein richtiges Verständnis der Spiritualität besteht zum Teil darin, unseren Begriff von Frieden zu erweitern, der viel mehr ist als das Nichtvorhandensein von Krieg. Der innere Frieden der Menschen hat viel zu tun mit der Pflege der Ökologie und mit dem Gemeinwohl, denn wenn er authentisch gelebt wird, spiegelt er sich in einem ausgeglichenen Lebensstil wider, verbunden mit einer Fähigkeit zum Staunen, die zur Vertiefung des Lebens führt. Die Natur ist voll von Worten der Liebe. Doch wie können wir sie hören mitten im ständigen Lärm? […] Viele Menschen spüren eine tiefe Unausgeglichenheit, die sie dazu bewegt, alles in Höchstgeschwindigkeit zu erledigen, um sich beschäftigt zu fühlen, in einer ständigen Hast, die sie wiederum dazu führt, alles um sich herum zu überfahren. Das wirkt sich aus auf die Art, die Umwelt zu behandeln. Eine ganzheitliche Ökologie beinhaltet auch, sich etwas Zeit zu nehmen, um den ruhigen Einklang mit der Schöpfung wiederzugewinnen, um über unseren Lebensstil und unsere Ideale nachzudenken, um den Schöpfer zu betrachten, der unter uns und in unserer Umgebung lebt und dessen Gegenwart „nicht hergestellt, sondern entdeckt, enthüllt werden muss.“ (LS 225)
Wenn wir das umsetzen, dann bricht das Reich Gottes an – es ist schon da – aber dann leben wir es konkret, meinte Pfarrer Jung. Jeder kleine Schritt zählt: „Viele kleine Leute, die an vielen kleinen Orten viele kleine Dinge tun, können das Gesicht der Welt verändern – auch und gerade zum Guten hin, zu einem „Biotop“, an dem vieles wachsen kann, wenn wir es wachsen lassen – ein guter Ort zum Leben für alle Menschen guten Willens.“
Mit diesen Worten schloss die inhaltlich sehr anspruchsvolle Predigt, die die Richtung vorgeben sollte für den heutigen Menschen im Spannungsfeld zwischen Konsum und dem überlebensnotwendigen Schutz der Umwelt. Gut daran war auch, wichtige Stellen aus Laudato si nochmals zu hören im Gedenken an Papst Franziskus.
Vieles an diesem Gottesdienst war außergewöhnlich, z. B. das Friedensgebet von Pfarrer Klaus Honermann, das Glaubensbekenntnis „Credo für die Erde“ der Dichterin und Theologin Dorothee Sölle oder auch die eindringliche Segensbitte aus Südafrika. Der überaus spärliche Besuch war freilich ein Wermutstropfen. Für die Gottesdienstbesucher gab es noch Sonnenblumensamen, damit die Saat zum „Erhalt der Schöpfung“, die in diesem Gottesdienst ausgestreut wurde auch aufgeht.
Walburga Arnold, Schwarzenbach/S.